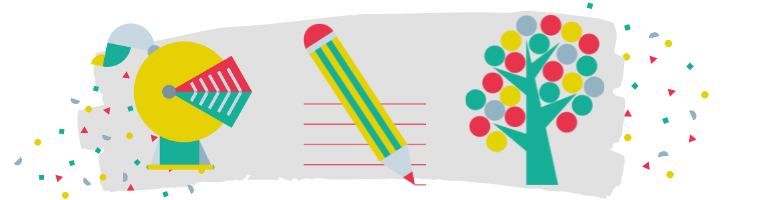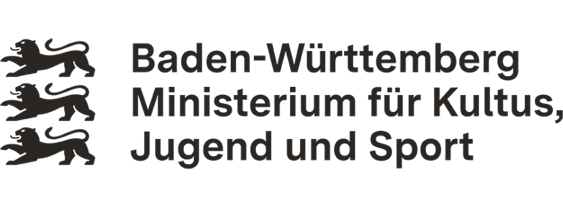Prof. Dr. Madelaine Böhme
Wie Steine von vor Millionen vor Jahren, Geheimnisse von heute lüften…
Wenn Großeltern von früher erzählen, dann sprechen sie meist von einem Früher, das 50 oder 60 Jahre her ist. Wenn Madelaine Böhme von „Früher“ spricht, ist das eine Zeit, die viel weiter zurückliegt. Die Geowissenschaftlerin und Paläontologin erforscht eine Zeit, die schon seit Millionen von Jahren vergangen ist. Wie das Leben damals aussah, steht für sie nicht etwa in den Sternen, sondern in den Steinen.

© Christoph Jäckle
Wenn Großeltern von früher erzählen, dann sprechen sie meist von einem Früher, das 50 oder 60 Jahre her ist. Wenn Madelaine Böhme von „Früher“ spricht, ist das eine Zeit, die viel weiter zurückliegt. Die Geowissenschaftlerin und Paläontologin erforscht eine Zeit, die schon seit Millionen von Jahren vergangen ist. Wie das Leben damals aussah, steht für sie nicht etwa in den Sternen, sondern in den Steinen.
In den Steinen fand sie auch das, was die Geschichte des aufrechten Ganges neu schreibt. Bisher dachten Forscherinnen und Forscher, der aufrechte Gang sei rund 6 Millionen Jahre alt. Die Funde, die Madelaine Böhme mit ihrem Team bei Ausgrabungen im Allgäu machte, weisen jedoch auf 12 Millionen Jahre hin. Warum man das an Knochen, die die Forschenden in zehn Meter Tiefe fanden, ablesen kann, das erklärt die Professorin in ihrer Kinder-Uni- Vorlesung am 27. Januar 2022.
Madelaine Böhme wuchs bei ihrem alleinerziehenden Vater auf. Ihre bulgarische Mutter war bei der Geburt verstorben, und so zog der Vater wieder von Bulgarien nach Dresden zurück. Der Vater war Lehrer, viel lieber wäre er aber Wissenschaftler geworden. Die Liebe zu Naturwissenschaft und Mathematik gab er seiner Tochter mit. In der Schule fühlte sie sich bald unterfordert: „Lernen musste ich nie, ich merkte mir, was im Unterricht gesagt wurde, lernte so aber auch früh, mich kreativ selber zu beschäftigen.“
Wenn Madelaine Böhme sich ihr Studium hätte aussuchen können, dann wäre sie vermutlich in einer Vergangenheit gelandet, aus der es menschliche Zeugnisse und Erzeugnisse gibt: Sie hätte Archäologie studiert. In ihrer Heimat, der damaligen DDR, orientierte sich das Studienangebot aber streng am Bedarf der Planwirtschaft. Für Archäologen gab es in der DDR wenig Verwendung, für Geologen jedoch schon. Denn die Geologie war nützlich für den Bergbau. Madelaine Böhme entschied sich für Geologie, bewarb sich und ergatterte einen der ebenfalls raren Studienplätze. Denn ein Professor hatte zu ihr gesagt: „Du interessiert dich für Fossilien, dann bist du hier richtig!“
Wie richtig, darauf wiesen schon die Schätze hin, die sie seit dem 10. Lebensjahr hütete. Sie hatte zwei steinerne Abdrücke von Seeigeln geschenkt bekommen. Die rätselhaften Fossilien spornten ihre Phantasie und ihren Wissensdrang an: „Ich hatte erst gedacht,es handelte sich um Seesterne. Das war für mich unvorstellbar, und ich wollte es unbedingt verstehen.“
Während andere sich zur Jugendweihe – das war in der DDR ein Ersatz für Konfirmation – Armbanduhren, Spiele oder Geld wünschten, hatte die 14- Jährige nur einen Wunsch: ein teures Fachbuch über Paläozoologie, das sie noch heute besitzt. Es kostete damals so viel wie eine Monatsmiete. Aber sie bekam es, schlug es auf und war zunächst enttäuscht: „Ich verstand kein einziges Wort.“
Doch das blieb nicht lange so. Nach und nach erschloss sie sich die geo-wissenschaftliche Sprache. Und Madelaine Böhme sollte sich noch viele Sprachen erschließen: Außer Deutsch und Bulgarisch spricht oder versteht sie noch sechs andere Sprachen.
Wie sich der aufrecht gehende Menschenaffe verständigte, dessen Knochen sie fand, das weiß sie natürlich nicht. Einen Namen hatte er auch nicht – und Udo schon gar nicht. Diesen Namen verpassten ihm die Forscherinnen und Forscher, denn sie fanden die wichtigsten Knochen an dem Tag, als der Liedermacher Udo Lindenberg seinen 70. Geburtstag feierte. Im Radio wurden dauernd seine Songs gespielt, und so taufte man die Knochen nach diesem prominenten und sehr aufrechten Udo.
Prof. Dr. Jan Born
Warum schlafen wir?
In dem großen Gebäude, in dem Prof. Jan Born arbeitet, stehen neben vielen Computern und Monitoren auch erstaunlich viele Betten. Nein, es ist keine Klinik. Und die Forscherinnen und Forscher arbeiten hier auch nicht so lange, dass es sich für sie gar nicht mehr lohnt, nach Hause zu gehen. Sie arbeiten zwar manchmal auch nachts, die Betten sind dennoch nicht für sie gedacht. Darin liegen Menschen, deren Schlaf untersucht wird. Sie schlafen also für die Wissenschaft. Denn das Institut, dessen Leiter der Psychologieprofessor ist, erforscht etwas, das nur auf den ersten Blick seltsam scheint: Es erforscht den Schlaf.

© Friedhelm Albrecht
Schlaf erscheint eigentlich langweilig. Da liegt jemand im Bett und atmet ruhig oder wälzt sich hin und her, weil er oder sie zu spät zu viel gegessen hat. Na und? Jan Born wird euch in seiner Vorlesung erklären, was im Schlaf alles passiert und was der Schlaf alles kann. Denn nicht nur die Träume eines Menschen sind aufschlussreich, auch der Schlaf als solcher. Man denkt, der Körper ruht sich nur aus, aber so einfach ist das nicht: Das Gehirn verarbeitet am Tag Erlerntes, und der Körper nutzt den Schlaf, um Stoffe zu produzieren, die helfen, Stress auszuhalten. Woher man das weiß? Man kann es an Blutproben erkennen und an mehr oder weniger zackigen Kurvenverläufen, die die Hirnströme wiedergeben. Kleine Metallplättchen, die an der Kopfhaut des Schlafenden angebracht werden, leiten die Erregungszustände an einen Monitor weiter. Das nennt man EEG (Elektroenzephalogramm).
Als Kind ahnte Jan Born natürlich nicht, dass er einmal ein bedeutender Schlafforscher werden würde. Er lebte mit seiner Familie im norddeutschen Celle und ging vermutlich genauso ungern ins Bett wie die meisten seiner Altersgenossen. Als jüngster von drei Söhnen hatte er eher darunter zu leiden, dass die beiden großen Brüder länger aufbleiben durften als er. Andererseits spornten die Brüder auch früh seinen Ehrgeiz an. „Ich war schon in jungen Jahren leistungsbetont, vielleicht weil ich mich als Jüngster oft nicht richtig ernst genommen fühlte“, sagt der Professor.
Für seine Eltern war Bildung wichtig, der Vater war Richter und die Mutter Lehrerin. Dennoch übten sie keinen Druck auf die Kinder aus. Schule hatte zu laufen, und wenn sie mal nicht ganz so gut lief, dann setzte sich die Mutter mit dem Jüngsten hin und lernte mit ihm Grammatik oder ähnliche Dinge, die nicht in den Kopf von Kindern wollen. „Ich war dann zwar wütend, aber auf die Weise habe ich Konjugieren und Deklinieren, also das Beugen von Verben und Hauptwörtern, gelernt.“
Jan Born kam in der Schule gut mit, er war aber kein Klassenprimus. Auf dem humanistischen Gymnasium, auf das er ging, mochte er besonders Mathe und Physik. Aber sein größtes Interesse weckte der Englischlehrer, der den Schülern eine Psychologie-AG anbot. Da wurde über Probleme geredet, die der 16-Jährige auch von sich kannte. Und er erfuhr, wie wichtig es ist, sich vom Elternhaus zu lösen und dass die Ablösung nicht auf einen Schlag kommen sollte. Er wäre gerne zum Einüben der Selbstständigkeit noch während der Schulzeit in eine eigene Wohnung gezogen. Doch da bremste ihn der Vater, indem er dem Sohn gestand, dass auch Eltern das Abstandnehmen erst lernen müssen.
Nach dem Abitur kam Born nach Tübingen, doch nicht gleich an die Uni, sondern zu einer Einrichtung, deren Botschafter er auch heute noch ist: Sie heißt Leibniz Kolleg. „Dieses Kolleg kann ich jedem empfehlen!“ Dort wohnen Abiturientinnen und Abiturienten zusammen in einem großen Haus, müssen sich im neuen Lebensabschnitt nicht einsam fühlen und können ein Jahr lang in alle möglichen Studienfächer hineinschnuppern. Nach diesem Jahren wissen die meisten, was sie studieren wollen.
Jan Born hatte aber in der Zwischenzeit einen Studienplatz in Tübingen im Fach Psychologie bekommen, und er begann schon während der Kolleg-Zeit mit dem Studium. Ihn interessierte die Abteilung der Psychologie, die sich mit körperlichen Vorgängen befasst, also der Medizin nahesteht. Seine Abschlussarbeit, die Diplomarbeit, schrieb er in den USA. Dort konnte er ein Jahr lang sehr selbstständig forschen, was ihm später zunutze kam.
Zurück in Deutschland arbeitete er in Ulm zusammen mit einem Endokrinologen, also einem Spezialisten für die Hormonproduktion des Körpers. „Da bin ich auf den Schlaf gekommen! Wir haben eines der ersten wissenschaftlichen Labore zur Erforschung von Hormonspiegeln im Schlaf aufgebaut.“ Labor klingt komisch, weil man gleich an Mikroskope und Chemikalien denkt. Im Schlaflabor nimmt man dagegen den Schlaf unter die Lupe. Jan Born konnte hier auch als einer der ersten den Zusammenhang zwischen Schlaf und Gedächtnis belegen.
Prof. Dr. Michael Butter
Warum glauben Menschen an Verschwörungen?
Prof. Dr. Michael Butter beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Verschwörungstheorien. Seit der Corona-Pandemie ist seine Forschung sehr gefragt und er hält viele Vorträge und tritt sogar im Fernsehen auf. Alle wollen wissen: Was sind Verschwörungen und warum glauben Menschen an sie? Diese Fragen wird der Wissenschaftler auch in der nächsten Folge der Kinder-Uni beantworten.

© Hector Kinderakademie
Michael Butter wollte eigentlich Lehrer werden. Er studierte die Fächer, in denen er schon in der Schule gut war, Englisch und Deutsch. Aber dann gefiel es ihm an der Universität so gut, dass er noch ein bisschen länger blieb und eine Doktorarbeit schrieb. In der Arbeit ging es darum, wie Adolf Hitler in amerikanischen Büchern oder Filmen in Szene gesetzt wird. Butter stellte fest, dass es vor allem in der Politik ganz nützlich ist, wenn man einen Superschurken wie Hitler vorführen kann. Man selbst sieht dann nämlich aus wie ein Superheld aus. Als er das erforschte, stieß Butter immer wieder auf komische Geschichten, in denen es um Verschwörungen geht. Also darum, dass Leute sich verabreden, um heimlich fiese Dinge zu tun. So entschloss er sich, aus dem Thema Verschwörungen sein zweites großes Buch zu machen. Das Buch, das man in Deutschland braucht, um Professor zu werden. In dem Buch beschäftigt sich Butter nicht mit echten, sondern vor allem mit eingebildeten Verschwörungen, mit Verschwörungstheorien.
Glauben eigentlich auch Kinder an Verschwörungen?
Das weiß man nicht so genau, sagt Butter, weil nicht klar ist, in welchem Alter man überhaupt schon an solche Dinge glauben kann. Wahrscheinlich fängt es im Alter von zehn, elf Jahren an, dass die Kinder sich so etwas wie Verschwörungen vorstellen können. Das sagen jedenfalls viele Lehrerinnen oder Lehrer. Meistens kommen die Verschwörungen in diesem Alter aber von den Eltern. Die Kinder wiederholen das, was sie zuhause hören. Oft ohne es wirklich zu verstehen.
Ob Verschwörer immer böse sind?
Da muss Butter überlegen. Und dann sagt er, dass es ja auch in gewissem Sinne eine Verschwörung sein kann, wenn sich Eltern und Verwandte zusammentun und den Kindern sagen, dass gleich der Weihnachtsmann vorbeikommt. Das ist dann eine Verschwörung, die nicht auf böse Ziele ausgerichtet ist. Bei den meisten Verschwörungen aber geht es um Gut und Böse und darum, dass die Verschwörer anderen Menschen schaden wollen.
Was macht ein Verschwörungstheorieforscher?
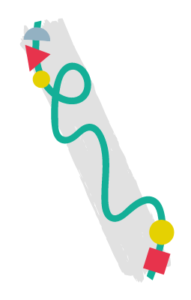
Ist er die ganze Zeit im Internet unterwegs, um nach den neuesten Verschwörungstheorien zu suchen? Nein. Die meiste Zeit ist Michael Butter ein ganz normaler Professor für Amerikanistik. Er unterrichtet, hält Vorlesungen über amerikanische Literatur und korrigiert die Arbeiten von Studierenden. Außerdem hat er ein Dutzend Doktorandinnen und Doktoranden, die für ihre Doktorarbeit forschen und ab und zu seinen Rat brauchen. Butter gefällt das Leben an der Uni. „Hier werde ich dafür bezahlt, dass ich Dinge machen kann, die mir Spaß machen, also Bücher zu lesen und Filme zu schauen und darüber zu sprechen.“ Was ihm auch Spaß macht: In Schulen oder andere Einrichtungen zu gehen und über Verschwörungstheorien zu informieren. Er hat selbst zwei Kinder und findet es wichtig, dass die Leute wissen, was Verschwörungstheorien sind, wie man sie erkennt und – wie man nicht auf sie hereinfällt.
Prof. Dr. Ewald Frie
Mehr als Gutenacht-Geschichten
Geschichte klingt gut, vor allem als Gutenacht-Geschichte. Geschichte als Fach besteht aber nicht nur aus gemütlichen Geschichten, da beschäftigt man sich nämlich mindestens so sehr mit spannendem, wie mit weniger spannendem und manchmal mit sehr ungemütlichem Stoff. Wer Professorin oder Professor für Geschichte ist, muss aber nicht alles über die gesamte Menschheitsgeschichte wissen. Ewald Frie ist Professor für Geschichte, aber er hat sich auf Neuere Geschichte spezialisiert. Die umfasst allerdings auch einen größeren Zeitraum, als man sich vorstellen kann: nämlich die letzten 500 Jahre.
In dieser Zeit ist viel passiert, hat sich viel entwickelt – nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Weil aber in den europäischen Schulen oft vergessen wird, dass es auch andere Erdteile mit eigener Geschichte und eigenen Geschichten gibt, hat Ewald Frie ein dickes Buch geschrieben, das Jugendlichen „Die Geschichte der Welt“ erzählt.
Darin erfahren sie Dinge, die auch viele Geschichtslehrerinnen und -lehrer nicht wissen. Zum Beispiel, wie die Menschen um 700 in einer chinesischen Millionenstadt lebten oder wie an der Pazifikküste des heutigen Peru vor 2000 Jahren riesige Pyramiden und tolle Kunstwerke entstanden und dass Europäer im Japan vor 150 Jahren als wild und ungebildet galten.

© FanyFazii
Ewald Frie schreibt also Bücher. Und er liest viele Bücher, denn wer selber viel liest, erfährt und weiß viele Dinge, die dann wiederum zu Büchern werden können. Ewald Frie hat immer gerne gelesen. Er konnte schon lesen und schreiben, bevor er in die Schule kam. Er lernte es, ohne dass es jemand groß gemerkt hätte. Wahrscheinlich hat er es sich von seinen älteren Geschwistern abgeguckt – die gaben ihm viele Möglichkeiten dazu. Er wurde nämlich als neuntes Kind in eine Bauernfamilie geboren. Nach ihm kamen noch zwei weitere Geschwister. Für Ewald Fries Entwicklung zum Wissenschaftler war nicht nur der frühe Ansporn zum Lesen wichtig, sondern auch dass er sehr früh merkte, dass der Alltag des Bauern und die Landwirtschaft gar nichts für ihn war. Als Kind drückte er sich erfolgreich vor allen bäuerlichen Tätigkeiten. „Ich war landwirtschaftlich eine Niete!„, gibt er zu. Bei so vielen Kindern fällt es zwar kaum auf, wenn eines verschwindet und in der Ecke sitzt und liest, doch seiner Mutter gefiel das sogar. Sie unterstützte den Bildungshunger des Jungen sehr. Er las sich also durch die Bücherei des nächsten Dorfes und er las sich, wenn grad nichts anderes da war, durch die Schulbücher seiner Geschwister.
Und weil die Mutter allen ihren Kindern mitgab, dass Lernen und Bildung enorm wichtig sind, haben auch fast alle Geschwister von Ewald Frie früher oder später studiert. Doch keine und keiner von ihnen hätte es geschafft, wenn sie dafür nicht vom Staat gefördert worden waren. Bafög, so heißt das Geld, das Schülerinnen, Schüler und Studierende bekommen, wenn ihre Eltern sich die Ausbildung oder das Studium der Kinder nicht leisten können. Ewald Frie findet, dass Bafög eine großartige Idee und seine Familie ein überzeugendes Beispiel dafür ist, wie diese staatliche Unterstützung die Chancen verbessern kann.
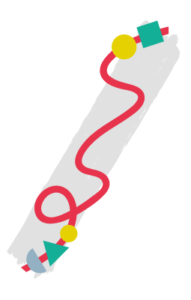
Für Ewald Frie war immer klar, dass er einmal studieren würde.
Die Schulzeit bereitete ihm keine Probleme, er lernte schnell, war aber nicht besonders fleißig, vor allem nicht im Kunstunterricht, da hatte er dann im Abizeugnis eine Vier minus. Doch nach der Schule wusste er erst nicht, welchen seiner vielen Interessen er im Studium nachgehen wollte. Schließlich waren es Geschichte und katholische Theologie, denn Ewald Frie kommt aus einem frommen Elternhaus. Er studierte in der Nähe seines Heimatortes, in Münster. Während des Studiums machte er schon Führungen in einem Museum und arbeitete im Stadtarchiv, also dort, wo alte Schriftstücke bewahrt werden.
Ewald Frie beschäftigte sich viel mit der Geschichte der Gegend, in der er lebte, er beschäftigte sich auch mit dem Thema Armut. Seine Doktorarbeit handelte davon, ob und wie armen Leuten vor rund 100 Jahren vom Staat geholfen wurde. Ewald Frie nahm sich vor, an der Universität zu bleiben und Professor zu werden. Seine erste Professorenstelle bekam er in Trier und von dort aus kam er nach Tübingen.
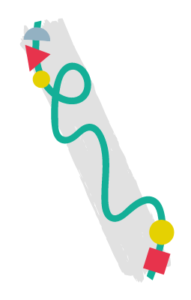
Wenn man einem Professor für Geschichte einen ganzen Tag lang zugucken würde, wäre das ziemlich langweilig. Da passiert nicht viel. Egal, was der Forscher in den Büchern entdeckt, von außen sieht es nicht aufregend aus. Die historische Forschung besteht ja vor allem aus Lesen von mehr oder weniger alten Schriften und Schreiben. Homeoffice ist dabei problemlos möglich, und Ewald Frie konnte sich, als seine Kinder klein waren, auch die Erziehungsarbeit gut mit seiner Frau teilen. Auch die Lehre betreibt der Professor in Coronazeiten meist von seinem Arbeitszimmer aus. Hier korrigiert er die Arbeiten der Studierenden und hier hält er die Online-Seminare.
Ewald Frie sitzt aber nicht nur am Schreibtisch, er ist auch sportlich, er ist gerne in der Natur, geht im Wald spazieren, fährt Fahrrad. Sein Verhältnis zur Natur ist jedoch weit von dem eines Bauern entfernt, es ist eben das eines Städters.
Prof. Dr. Thomas Iftner
Warum machen manche Viren krank?
Thomas Iftner ist Direktor des Instituts für Medizinische Virologie und Epidemiologie in Tübingen. Früher wussten nur wenige etwas mit seiner Wissenschaft anzufangen, seit Beginn der Corona-Pandemie ist sie sehr gefragt. Virologen beschäftigen sich mit Viren, die sind so winzig klein, dass man sie auch unter einem normalen Mikroskop nicht sehen kann. Längst nicht alle Viren machen krank, viele sind völlig harmlos und gegen viele kann der menschliche Körper mit seiner Immunabwehr erfolgreich ankämpfen.

© Verena Müller
Ihn interessiert das ganz Kleine und das ganz Große
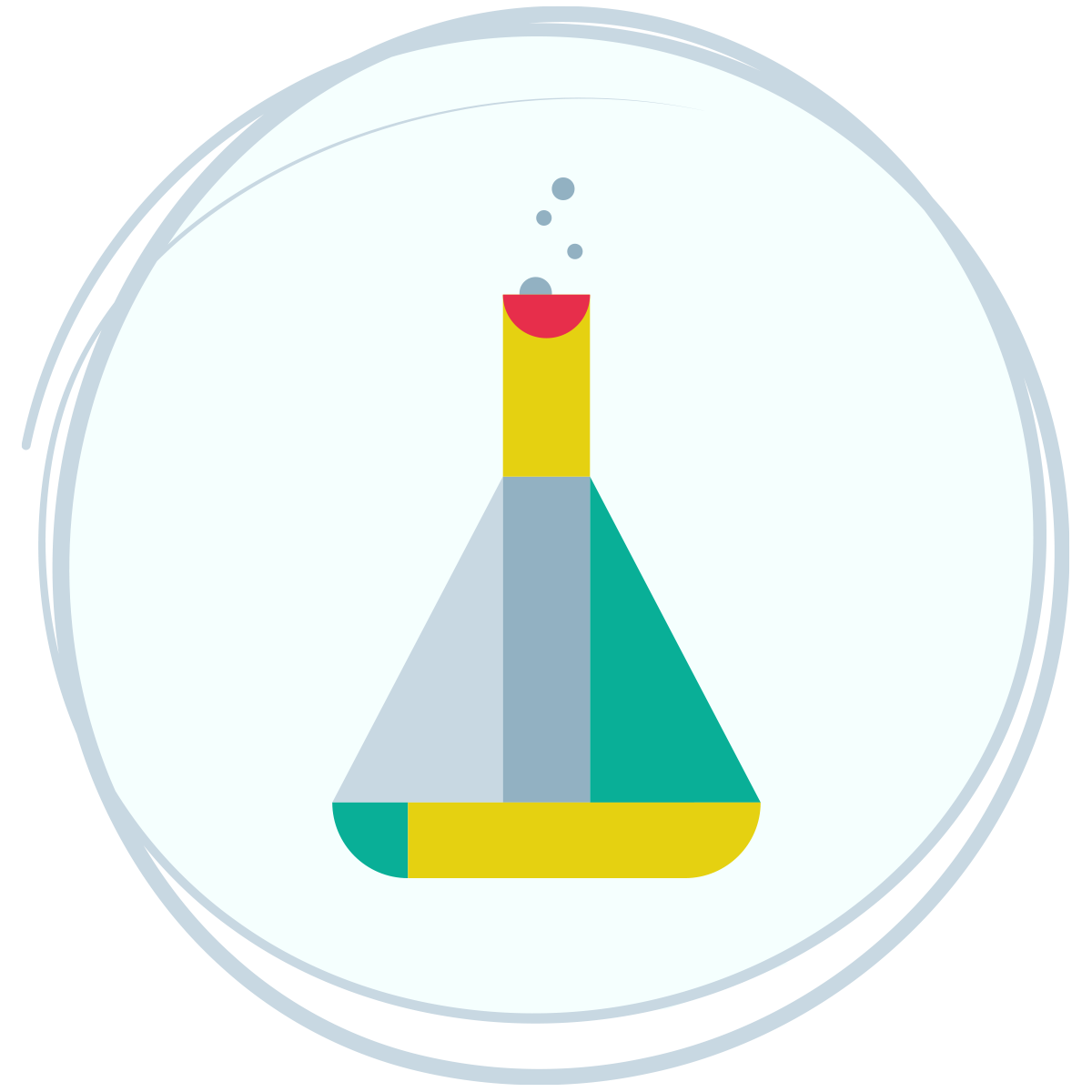
Lange bevor Thomas Iftner Professor für Virologie wurde, war ihm klar, dass er Wissenschaftler werden wollte. Schon als Kind ging er den Dingen auf den Grund. Die Biologie interessierte ihn sehr, sie wurde auch zu seinem Lieblingsfach in der Schule.
Dabei waren es nicht die Blumen, Bäume oder Tiere, die ihn begeisterten, er wollte alles wissen über den Bauplan des Lebens. Ihn interessierte das ganz Kleine, aber auch das ganz Große. Wenn er nicht Biologie studiert hätte, hätte er sich vielleicht das Universum vorgenommen, er wäre Astronom oder Astrophysiker geworden.
Er war ein Bücherwurm
Als Kind las er viele Bücher, ständig war er in der Bibliothek seiner Heimatstadt. Die Stadt heißt Fürth und liegt in Bayern. Und weil er keine Geschwister hatte, auch nur wenige Spielkameraden in der Nähe waren, war ihm manchmal langweilig. So las er sich eben durch die Stadtbücherei und landete früh in der Erwachsenenabteilung. Romane, Sachbücher – er verschlang, was er kriegen konnte.
In der 7. Klasse war er faul
Schulbücher standen allerdings bei ihm nicht so hoch im Kurs. Schule interessierte ihn nicht besonders, in der 7. Klasse blieb er sitzen – wegen Latein und wegen Faulheit. Das änderte sich dann bis zum Abitur, mit wenig Aufwand kriegte er einen Schnitt von 2,3 hin.
Es gab noch keine Handys
Nach der Schulzeit konnte er sich endlich auf seine wirklichen Interessen konzentrieren. Er studierte Biologie. Computer-Wissenschaft, also Informatik, hätte ihn auch begeistert. Doch in seiner Studienzeit, in den 1980er Jahren waren Computer zwar schon erfunden, aber es mussten noch einige Jahrzehnte vergehen, bis jede und jeder ein Handy in der Hand halten und sich damit Bilder und Nachrichten schicken konnte.
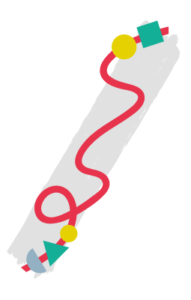
Er hat wahnsinnig schnelle Assistenten
Thomas Iftner arbeitet heute mit vielen großen und sehr leistungsfähigen Computern. Da kann einer locker mal 250 000 Euro kosten. Diese Maschinen vergleichen und verarbeiten in Wahnsinnsgeschwindigkeit Daten. Früher mussten Wissenschaftler sich mit viel Handarbeit behelfen. Heute erledigen Rechner diese Aufgabe in einem Mordstempo und mit links. Merkwürdig ist es schon, dass man so große Apparate benötigt, um etwas über die Zusammensetzung so kleiner Elemente wie Viren herauszufinden.
Er muss sich dauernd umziehen
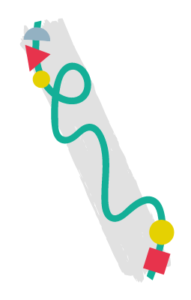
Thomas Iftner hat sich in seinem Forscherleben vor allem mit einem Virus beschäftigt, das Tumoren auslösen kann: das Papillomvirus. Es verursacht gut- und bösartige Wucherungen der Haut und der Schleimhäute, also ungefährliche und gefährliche Wucherungen. Zur Zeit haben Thomas Iftner, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber vor allem mit einem anderen Virus zu tun, dem Coronavirus, das Covid 19 auslöst.
Dieses Virus ist sehr ansteckend, und deshalb müssen sein Team und er in den Laboren des Instituts Schutzkleidung anziehen, sie häufig wechseln und sich andauernd die Hände desinfizieren. Denn die Forschung soll ja nicht die Forschenden gefährden.
Prof. Dr. Uwe Ilg
Unser Gehirn gibt viele Rätsel auf…
Wer wüsste nicht gerne mehr über das eigene Gehirn? Wie es arbeitet oder nicht arbeitet, warum der Gedanke an ein Schokoladeneis einen nicht loslässt, aber die Hausaufgaben sehr schnell wieder vergessen sind. Warum gehorcht der Körper dem Gehirn oder vielleicht ist es gerade umgekehrt? Und was macht das Gehirn, wenn der Mensch schläft? Schläft es dann auch? Das Gehirn gibt viele Rätsel auf, und es ist ein spannendes und unerschöpfliches Forschungsfeld.

© Eberhard Karls Universität Tübingen
Prof. Uwe Ilg beschäftigt sich schon sein ganzes Forscherleben lang damit und könnte sich noch viele Forscherleben länger damit beschäftigen, ohne alle Rätsel gelöst zu haben. Sicher werden in den nächsten Jahren noch viele kluge Köpfe viele aufregende Dinge über das menschliche Gehirn herausbekommen. Denn an der Erforschung des Gehirns, das unter anderem aus Unmengen von Neuronen (Nervenzellen) besteht, arbeiten heute überall auf der Welt eine Vielzahl von Neurowissenschaftlerinnen und -wissenschaftler.
Uwe Ilg hat zunächst ein Fach studiert, das gar nicht so sehr an Hirnforschung denken lässt. Sein Fach ist die Biologie. Er hätte fast auch Physik studiert. Diese beiden Fächer mochte er in der Schule ganz besonders. Und dazu kam noch Sport. Uwe Ilg war ein As im Schwimmen und so brachte er es im Abi auf 15 Punkte in Sport. In Physik und Bio war er auch sehr gut, die anderen Unterrichtsfächer interessierten ihn nur mäßig. Er hatte das Glück, so sagt der Hirnforscher, dass man zu seiner Abizeit erstmals viele Fächer abwählen konnte, und so konnte er sich die letzten Schuljahre ganz nach seinem Geschmack und seinen Fähigkeiten zusammenbauen. Sein Interesse an Biologie hatte übrigens sein Onkel geweckt. Der war Ornithologe, also Vogelkundler, und mit ihm ging Uwe Ilg in seiner Kindheit oft in den Wald.
Doch im Biologiestudium waren es dann nicht die Tiere, denen sein Forschungsinteresse galt. Von Anfang an war es das Gehirn und später dann die spezielle Verbindung zwischen Auge und Gehirn. Es ist nämlich nicht so, dass alle immer das Gleiche sehen. Das Gehirn kann die Augen überlisten und ihnen etwas vormachen. Diese Vorgänge sind reichlich kompliziert – beim Aufklären der Täuschungsmanöver helfen Rechner.
Die Computerwissenschaft war in den Achtzigerjahren noch sehr am Anfang. Heute denkt man, die Informatik – so heißt das Fach, das sich mit der Verarbeitung von Informationen oder Daten beschäftigt – hätte es schon immer gegeben. In den Achtzigerjahren war es noch wenig verbreitet, eher mal ein Spezialgebiet der Mathematik. Heute kann man sogar ein Fach studieren, das Bioinformatik heißt. Es ist sehr nützlich für die Medizin und auch die Biologie, um wahnsinnsschnell große Mengen an Informationen zu verarbeiten.
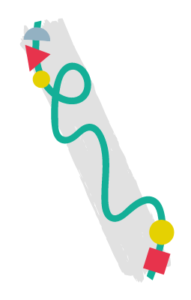
Uwe Ilg, der zunächst in seiner Heimatstadt Ulm studierte und hier von seinem Professor als Talent erkannt wurde, machte nach Ende des Studiums einen großen Sprung nach Washington. Dort arbeitete er in einem Forschungsinstitut an seiner Doktorarbeit. Fast wäre er auch in den USA geblieben, doch seine Frau wollte lieber in Tübingen leben. Seit 1992 arbeitet Uwe Ilg also in Tübingen, wo er auch Professor wurde. Aber er forscht hier nicht nur, sondern – und das ist etwas ganz Besonderes, das leistet sich sonst kaum eine andere Universität – er vermittelt seine Wissenschaft auch Schülerinnen und Schülern. Im Schülerlabor.
Seit 2008 gibt es das in Tübingen, und Uwe Ilg ist sein Leiter. Jedes Jahr bekommen hier Kinder und Jugendliche aus Süddeutschland, aber auch aus der ganzen Welt Grundlagen der Neurowissenschaften vermittelt. Sie können hier – anders als in der Schule – selber forschen und konstruieren. Und erstaunliche Entdeckungen machen: Zum Beispiel sehen, dass Fische elektrische Ströme aussenden und sich damit orientieren.
Wichtiges Werkzeug im Schülerlabor sind die Computer. Computer, das weiß spätestens seit der Corona-Pandemie jedes Kind, sind ja nicht nur zum Spielen da, sie helfen noch viel mehr beim Lernen und sie helfen beim Forschen. Mit Computern kann man zum Beispiel Hirnströme messen. Wenn man entsprechende Stöpsel oder Elektroden auf dem Kopf eines Menschen platziert, dann kann man auf dem Bildschirm sehen, welche Teile des Gehirns gerade aktiv sind. Aber Gedanken kann man mit ihnen nicht lesen. Das wäre auch sehr unheimlich.
Prof. Dr. Nüsslein-Volhard
Warum machen sich Tiere schön?
Für viele sind die kleinen Fruchtfliegen nur lästig; Christiane Nüsslein-Volhard aber schaute sich ihre Gene genau an und fand dabei eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Menschen. Dank dieser Entdeckung wurde sie berühmt und mit dem höchsten Forschungspreis der Welt geehrt. Sie blieb dennoch nicht für alle Zeiten Fliegenforscherin: Daher sieht es in einigen Räumen des Tübinger Instituts, an dem sie lange Direktorin war, aus wie in einem Aquarium.

© Hector Kinderakademie
Faszination für Flora und Fauna schon von Kindesbeinen an…
Pflanzen und Tiere begeisterten Christiane Nüsslein-Volhard schon als Vorschulkind. Eifrig lernte sie die Namen, lernte die verschiedenen Arten zu unterscheiden und liebte es, bei sehr netten Leute auf einem Bauernhof bei Frankfurt zwischen Pferden, Hühnern und auf Wiesen voller Blumen und Bäumen herumzustreifen. Die kleine Naturforscherin sammelte, was die Botanik hergab und fing schon früh die Schönheit der Pflanzen ein, indem sie sie zeichnete. Zeichnen war immer eine ihrer Leidenschaften. Mit Malen, Musik und Büchern wuchsen alle fünf Kinder der Familie Volhard auf.
Von durchschnittlichen Schulnoten zum Nobelpreis
In der Schule hatte Christiane Nüsslein-Volhard nicht die tollsten Noten. Die Natur erschien ihr spannender als der Unterricht. Die Frau, die zu den weltweit besten Forscherinnen und Forschern gehört, sagt erstaunlicherweise: „Ich war nicht auffällig begabt und ich war nicht besonders gut in der Schule.“ Dabei bekam sie 1995 in Stockholm den wichtigsten Forschungspreis der Welt, den Nobelpreis. In ihrem Fall war es der für Physiologie und Medizin. Damals war sie 53 Jahre alt und hatte schon ein reiches Forscherleben hinter sich.
Ja, und wofür bekam sie den Nobelpreis?
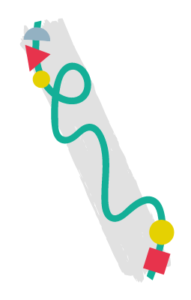
Dafür, dass sie herausfand, wie die Gene der Fliegen die Entwicklung steuern, und das beim Menschen ganz ähnlich funktioniert. Sie fand dann auch das „Toll“-Gen, das bei der Fliege für die Bauch-Rückenachse zuständig ist. Es kam per Zufall heraus, dass es auch beim Immunsystem von Fliegen und bei dem vom Menschen eine wichtige Rolle spielt . Als sie zusammen mit einem Forscherkollegen dieses Gen entdeckte, riefen beide „toll“. Ein anderes Gen taufte Christiane Nüsslein-Volhard „Schnurri-Gen“. Auch Spitzenforscher haben Sinn für Komik.
Prof. Dr. Bernhard Schölkopf
Warum sind Computer dumm?
Prof. Dr. Bernhard Schölkopf arbeitet in einem sehr modernen Gebäude in Tübingen, dem Max Planck-Institut für Intelligente Systeme. In dem Gebäude hat man einen tollen Ausblick auf die Schwäbische Alb, es gibt große unterirdische Hallen mit Robotern und Messgeräten darin, aber auch gemütliche Sofas und Büros mit vielen Rechnern darin. Was es auch gibt, sind Tafeln, wie in der Schule. Im Max-Planck-Institut reichen sie vom Boden bis zur Decke, weil die Forscher viel Platz zum Schreiben brauchen. Vor allem, wenn sie mit Kolleginnen und Kollegen über ihre Formeln diskutieren.

© Herlinde Koelbl
Bernhard Schölkopf ist Direktor am Max-Planck-Institut. Er leitet eine Abteilung, die einen ziemlich komplizierten Namen trägt: Abteilung für Empirische Inferenz. Fragt man den Professor, was das bedeutet, empirische Inferenz, dann sagt er: „Es geht darum, wie man aus Beobachtungen auf Gesetzmäßigkeiten schließt“.
Bernhard Schölkopfs Team beschäftigt sich unter anderem mit Gehirnsignalen. Das sind elektrische Impulse, die das Gehirn beim Arbeiten aussendet. Wenn man einer Versuchsperson eine Art Badekappe aufsetzt mit ganz vielen Anschlüssen drauf, kann man die Signale messen, die das Gehirn am Tag und sogar in der Nacht aussendet. Leider sendet ein Gehirn unglaublich viele Signale aus, es ist ein gigantisches elektrisches Getöse, in dem ein einzelnes Signal, etwa fürs Armheben, total untergeht. Aber: Es gibt Computer, die mit Künstlicher Intelligenz selbst in gigantischen Datenmengen interessante Muster finden. Sie entdecken in dem Getöse manchmal sogar das Signal, mit dem man einen Arm heben kann.
Die Forscherinnen und Forscher im Max-Planck-Institut arbeiten daran, diese Suche immer besser zu machen. Sie trainieren die Maschinen, füttern sie mit ganz vielen Daten, bis sie irgendwann lernen, selbst im Datengetöse aus der Badekappe Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Eines Tages können so vielleicht Menschen mit Gehirnschäden wieder ihren Arm bewegen. Oder einen Computer steuern. Oder eine Botschaft an Freunde schicken, wenn sie sich, wie Stephen Hawking, überhaupt nicht mehr bewegen können. Künstliche Intelligenz kann man für unglaublich viele Aufgaben nutzen. In der Medizin, in der Astronomie, aber auch beim Shoppen oder Autofahren. KI verändert die ganze Welt, sagt Schölkopf. Der Wissenschaftler kennt sich gut aus mit Künstlicher Intelligenz. Er ist einer der besten KI-Forscher der Welt, Mitbegründer des Cyber Valley in Baden-Württemberg
Dabei sollte er eigentlich, wie sein Vater, Maurermeister werden. „Ich bin ein bisschen aus der Art geschlagen“, sagt er. Die Eltern merkten bald, dass ihr Sohn den Baubetrieb des Vaters wohl nicht übernehmen würde. Dazu war er einfach zu gut in der Schule. Er studierte schon als Kind mit großer Leidenschaft das „Lexikon unseres Planetensystems“ und beobachtete mit einem Teleskop die Sterne. Natürlich sah er auch gern Star Wars-Filme. Die Schlachten der Sternenkreuzer waren aber nicht die Hauptsache für ihn. Mehr faszinierten ihn die Reisen durch das Sternensystem und die intelligenten Roboter wie R2D2. In Tübingen studierte Schölkopf erst mal Theoretische Physik. „Aber wenn man es wirklich ernst meint damit, muss man noch Mathe dazu studieren.“ Bald kam auch noch die Gehirnforschung und die Philosophie dazu. „Ich war in einer Arbeitsgruppe bei den Theologen“, erinnert er sich. „Da ging es darum, wie das Gehirn die Wirklichkeit konstruiert.“ Schölkopf fand das alles sehr spannend.
In seiner Arbeit am Max Planck-Institut kann der Wissenschaftler heute all seine Interessen vereinen. Mathe und Physik, Gehirnforschung und sogar Astronomie: „Wir entwickeln Programme, mit denen man nach Planeten suchen kann, die bewohnbar sein könnten.“ Programme zu schreiben, macht riesigen Spaß, findet Schölkopf. Und es sei gar nicht so schwierig. „Ganz normale Smartphones können heute mehr als die Computer, mit denen ich das Programmieren gelernt habe.“
Schölkopf rät deshalb allen Schülerinnen und Schülern, das Programmieren einfach mal auszuprobieren. Und ihre Smartphones und Computer nicht nur für Videospiele zu nutzen.
Prof. Dr. Ansgar Thiel
Warum werden Sportler*innen immer besser?
Wer denkt, ein Professor für Sportwissenschaften verbringt viel Zeit auf dem Trainingsplatz und zeigt Studierenden, wie man einen Salto macht oder einen Speer wirft, der irrt sich. Ansgar Thiel ist praktisch nie auf dem Trainingsplatz zu finden. Wie die meisten Wissenschaftler*innen verbringt er viel Zeit im Büro. Hier liest und schreibt er Aufsätze, spricht mit Doktorand*innen über ihre Forschungen.

© Hector Kinderakademie
Thiel und seine Mitarbeitenden erforschen, warum Sportler*innen so viele Schmerzmittel nehmen. Oder wie man alte Menschen in Pflegeheimen dazu bringen kann, sich mehr zu bewegen. Oder wie Sportler*innen mit dem Training klarkommen: „Sportler*innen sind sehr unterschiedlich, manche trainieren extrem diszipliniert und sind sehr fleißig, anderen fällt das Training schwer. Wir wollen herausfinden, was das mit ihrem Leben zu tun hat. “
Ansgar Thiel hat als Kind viel Sport gemacht. Fußball, Handball, Laufen. Seinen Eltern war das wichtig. Sie waren keine Akademiker*innen, aber sie haben darauf geachtet, dass all ihre fünf Kinder Sport treiben und ein Musikinstrument lernen. Ansgar Thiel hat Trompete gespielt und war sogar mal Mitglied einer Punkband. Die Schule hat ihm nicht besonders gefallen: „Ich war in den meisten Fächern einigermaßen gut, aber habe mich nicht besonders angestrengt und fand es eher langweilig. Ich bin hauptsächlich zur Schule gegangen, weil ich da meine Freunde getroffen habe.“ Hat er denn auf der Schule etwas fürs Leben gelernt? „(Sehr langes Überlegen) Ja, vielleicht in Deutsch oder Latein.“
Wenn es nach Ansgar Thiel ginge, würde die Schule anders aussehen. „Mathe ist eigentlich ein total spannendes Fach, aber so abstrakt wie es vermittelt wird, gefällt es nur Schüler*innen, denen es leicht fällt.“ Thiel würde Mathe in andere Fächer einbauen, in Sport zum Beispiel. „Sport ist eigentlich eine Mischung von ganz vielen Disziplinen. Da geht es darum, wie man sich motiviert, also um die Psyche, aber auch um das Soziale, die Mannschaft, und um Biologie, Medizin, Physik und Mathe.“ Mathe? Ja. Gute Sportler*innen müssen beim Training sehr genau darauf achten, wie sie sich am besten bewegen. „Um herauszufinden, wie man laufen muss, um richtig schnell zu werden, braucht man zum Beispiel die Integralrechnung.“
Was man auch braucht, ist Disziplin. Ohne hartes Training kommt man im Sport nicht weiter, da lässt Thiel keinen Zweifel dran. Dass heute viele so tun, als könne man seine Ziele ganz bequem erreichen, stört ihn. „Heute sind Influencer*innen für viele Jugendliche ein Vorbild. Aber auch Influencer wie PewDiePi quatschen in ihren Videos nicht einfach drauf los, die bereiten sich gründlich vor, das ist harte Arbeit.“ Großen Respekt bei Jugendlichen genießen auch Parkours-Sportler*innen, die sich über Mauern hangeln und Wände hochklettern. „Aber wer richtig gut sein will im Parkours, muss täglich sechs Stunden üben.“
Sportwissenschaftler*innen wie Thiel interessieren sich dafür, wie die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen sich verändern. Denn das hat Folgen für den Sport. „Junge Sportler*innen machen heute nicht mehr einfach das, was andere machen oder was der Trainer ihnen sagt. Sie wollen selbst mitentscheiden, legen Wert auf Coolness und gutes Aussehen und wollen das auch bei Instagram oder Tiktok zeigen.“ Der klassische Leistungssport ist ihnen nicht mehr so wichtig, meint Thiel. Er berät deshalb den Deutschen Fußballbund, wie man Jugendliche heute am besten motiviert.
Wie hält es Thiel selbst mit dem Sport? Hat er dafür überhaupt noch Zeit? Klar. „Ich mache jeden Morgen vor dem Frühstück 30 Minuten Workout.“ Und einmal die Woche trifft er sich mit Freunden zum Boulespiel. Das Werfen mit den Kugeln sieht auf den ersten Blick nicht besonders anstrengend aus, eher wie eine entspannte Freizeitbeschäftigung. Aber dieser Eindruck täuscht: „Wenn wir Boule spielen, unterhalten wir uns höchstens über das Boulespielen. Die Kugeln richtig zu werfen auf dem rauen Untergrund, ist kompliziert. Da spielen Physik und Mathematik eine Rolle.“ Und wie in anderen Sportarten muss man Boule ernsthaft trainieren und sich aufs Spiel konzentrieren. Boulespieler*innen wollen nämlich besser werden, wie alle Sportler*innen. Das ist übrigens das Besondere am Sport. Niemand muss Olympiasieger werden, aber jeder kann ein bisschen besser werden, wenn er will. „Und besser zu werden, ist einfach ein tolles Gefühl“, sagt Thiel.
Prof. Dr. Rita Triebskorn
Warum haben Schnecken Stress?
Rita Triebskorn ist Ökotoxikologin. Sie erforscht, wie Arzneimittel oder Schädlingsbekämpfungsmittel auf Tiere wirken, und fand heraus, dass die Tiere dadurch richtig viel Stress bekommen. Deshalb setzt sie sich dafür ein, dass solche Stoffe nicht in Bäche oder Flüsse gelangen. Besonders interessant findet sie Schnecken, die haben ihr schon als Kind gefallen. Leider sind Schnecken auch sehr gefräßig und gefährden die Ernte von Bauern. Deshalb hat sie gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern ein Schneckengift entwickelt, das Schnecken tötet, aber der Natur nicht schadet. Ein Interview.

© Eberhard Karls Universität Tübingen
Wann wurde Rita Triebskorn Schneckenforscherin?

Als Rita Triebskorn klein war, verbrachte sie viel Zeit bei den Großeltern und ihren beiden Großtanten. Die kannten sich mit der Natur gut aus und nahmen die kleine Rita viel mit nach draußen, in den Garten und den Wald. Dort konnte sie auf Bäume klettern, am Bach matschen, mit der Schaufel graben, Tomaten pflanzen, und Schnecken untersuchen. Das war genau ihr Ding.
Vor allem die Schnecken schloss sie schon als kleines Kind ins Herz: „Die fand ich faszinierend.“ Weil Rita Triebskorn jemand ist, die macht, was ihr gefällt, beschloss sie, Biologie zu studieren und wurde Schneckenforscherin. Das heißt: Eigentlich nennt sie sich Ökotoxikologin. Das ist ein kompliziertes Wort, in dem das griechische Wort für Umwelt (oikos) und Gift (toxikon) drin steckt. Ökotoxikologen erforschen, wie Gift auf die Umwelt wirkt.
Kriegen Fische Medikamente?
Leider ja. Die Überreste von Arzneimitteln oder auch Schädlingsbekämpfungsmitteln landen oft in Flüssen, Seen oder Bächen. Es sind zwar keine große Mengen, sagt die Forscherin, aber es ist ein „richtiger Cocktail“, ganz viele verschiedene Substanzen, die sich im Wasser verteilen. Was passiert, wenn Fische oder andere Flussbewohner diesen Cocktail aufnehmen? „Sie kriegen Stress“, sagt Triebskorn, weshalb sie die Gifte auch „Stressoren“ nennt. Ein „Stressor“ wie etwa das bekannte Schädlingsbekämpfungsmittel „Glyphosat“ kann die Bakterienkultur im Körper von Organismen verändern. Und, wenn sich das Gift anreichert, kann der Stressor Tiere und Menschen krank machen.
Muss man Schnecken töten?
Leider kann man auf Arzneimittel nicht verzichten und viele Bauern brauchen auch Schädlingsbekämpfungsmittel, um ihre Ernte zu sichern. Für ihre Doktorarbeit hat sich Rita Triebskorn deshalb überlegt, ob es nicht Schädlingsbekämpfungsmittel gibt, die möglichst wenig Schaden in der Umwelt anrichtet. Zusammen mit anderen Forschern entwickelte sie ein neues Schneckengift. Es tötet die gefräßigen Schnecken, löst sich danach aber wieder auf, ohne die Natur zu belasten. Das Schneckenkorn kann man heute noch kaufen.
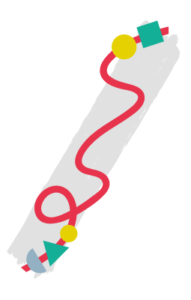
Warum Biologie perfekt für Kinder ist
Die Wissenschaftlerin forscht nicht nur, um Aufsätze zu schreiben, die hinterher ein paar Leute lesen. Sie will, dass die Welt besser wird. Und so hat sie sich gemeinsam mit anderen Forschern dafür eingesetzt, dass Klärwerke eine vierte Reinigungsstufe bekommen Die Wissenschaftler hatten Erfolg: Die Europäische Union plant mittlerweile die Einführung einer solchen zusätzlichen Wasserreinigung. Wissenschaftler können also wirklich etwas tun für die Umwelt. Rita Triebskorn ermutigt deshalb alle Kinder, sich früh für die Natur und die Umwelt zu interessieren. Sie selbst zog schon öfter mit Kindern los, um am Bach Fische, Würmer und Schnecken zu untersuchen. Wenn dabei jemand mal ins Wasser fällt: Egal. „Sowas ist nicht schlimm“, sagt Triebskorn. Sie findet bis heute, dass Biologie einfach riesig Spaß macht. Für Kinder ist es die perfekte Wissenschaft: Man kann am Bach matschen, mit Tieren spielen, zugucken, wie Pflanzen wachsen. Und sein Zimmer aufräumen muss man auch nicht.
Prof. Dr. Ulrike von Luxburg
Warum ist Künstliche Intelligenz nicht immer gerecht?
Als Kind hatte Ulrike von Luxburg mit Computern und Mathe nicht viel im Sinn. Die Tübinger Informatik-Professorin ist im Jahr 1975 geboren und in Königsbrunn aufgewachsen, einer kleinen Stadt bei Augsburg. Als Kind spielte sie lieber draußen in der Natur als Rechenaufgaben zu lösen. „Ich dachte, Mathe kann ich sowieso nicht, das ist alles Mist.“ Sie war auch keine von den Nerds, die ständig an ihrem Rechner herumschrauben oder Computerspiele spielen müssen. „Ich hatte zuhause gar keinen Computer.“ Ihre Eltern waren Psycholog*innen und interessierten sich nicht besonders für Mathematik. „Aber sie hatten auch nichts dagegen, als ich mich dafür interessierte.“

© Hector Kinderakademie
Das passierte, als Luxburg in der neunten Klasse war. „Da gab es einen Mathelehrer, der hat den Stoff einfach spannend präsentiert.“ Der Lehrer traf den richtigen Ton, und der Unterricht machte plötzlich Spaß: „Ich glaube, das lag daran, dass der Lehrer das Fach selber liebte.“ So wurde Luxburg immer besser in Mathe und beschloss, das Fach zu studieren. Eine gute Entscheidung, auch wenn es im Studium viel mehr Herausforderungen gab als in der Schule. „Wenn man Mathe an der Uni studiert, kommt man schon an seine Grenzen.“
Das Problem von Mathematiker*innenn ist, dass sie über ihren Beruf nur mit sehr wenigen Leuten sprechen können: Wer kennt sich schon aus mit Shimura-Varietäten oder der Toeplitz-Vermutung? „Ich wollte aber ein paar mehr Menschen erreichen“, sagt Luxburg, „und auch etwas angewandter forschen.“ So konzentrierte sie sich zunehmend auf ihr Nebenfach, die Informatik. Das wurde in Konstanz, ihrem ersten Studienort, gerade aufgebaut. „Da hatten wir traumhafte Bedingungen, es gab fast für jeden Studierenden einen Betreuer.“
Informatiker*innen entwickeln Programme für Computer. Das heißt: Sie schreiben in einer bestimmten Programmiersprache Befehle, die einem Rechner sagen, was er tun soll, also zum Beispiel eine komplizierte Rechenaufgabe lösen oder ein Raumschiff auf einem Bildschirm von links nach rechts fliegen lassen. Interessant wird es, wenn der Rechner nicht das tut, was die Programmierer*innen wollen. „Da muss man dann schauen, wo ist der Fehler? Fehlt irgendwo ein Strichpunkt? Oder eine „0“? Und wenn man alle Fehler gefunden hat und das Programm tut, was es soll, dann ist das ein richtig cooles Gefühl.“ Für Luxburg ist das Spannende an der Informatik genau dieses Knobeln. „Jemand, der oder die gern Rätsel löst, ist in der Informatik richtig.“ Manche Rätsel sind so spannend, dass man sehr lange darüber nachdenken muss. „Es kommt vor, dass man ein, zwei Jahre knobelt, bis man eine Lösung gefunden hat.“
Gut an der Informatik ist auch, dass sie so vielseitig ist. Luxburg ist Sprecherin einer großen Gruppe von Wissenschaftler*innen an der Tübinger Uni, dem „Exzellenzcluster Maschinelles Lernen“. Dort werden Programme entwickelt, mit deren Hilfe man aus den unglaublich vielen Daten, die Wissenschaftler aus anderen Fächern bei ihren Forschungen einsammeln, Erkenntnisse gewinnen kann. In der Archäologie gibt es zum Beispiel ein Projekt, das alle Ausgrabungen auf der Erde erfassen will. „Da sitzen Leute, die geben jeden einzelnen Fund, jeden Faustkeil, der jemals gefunden wurde, jeden Knochen, jeden Pollenrest in eine Datenbank ein.“ Es ist eine gigantisch große Datenbank, die kein Mensch komplett durchsehen kann. Die Wissenschaftler*innen arbeiten deshalb mit Informatikern aus dem Exzellenz-Cluster zusammen, die sich mit Künstlicher Intelligenz auskennen. Mit intelligenten Programmen kann man diese unzähligen Daten nämlich verarbeiten und Schlüsse daraus ziehen. Also zum Beispiel sagen, warum die Menschen in der Urzeit ihre Heimat verlassen haben und sich auf lange Wanderungen begaben. Sind sie aufgebrochen, weil die Lebensbedingungen in ihrer alten Heimat so schlecht wurden? Oder wollten sie in der Ferne neues Land erschließen? „Dafür kann man Informationen über die Pflanzen, die damals wuchsen, und das Wetter, das damals herrschte, in Verbindung bringen mit den Funden in der Datenbank und dem, was man über die Ernährung der Urmenschen weiß, über ihre Kleidung, ihre Gesundheit oder ihre Werkzeuge.“
Mit intelligenten Programmen kann man also unglaublich viele Dinge machen. Die Programme können feststellen, ob jemand ernsthaft erkrankt ist, sie können ein selbstfahrendes Auto steuern oder vorhersagen, ob jemand seinen Kredit nicht zurückzahlen wird. Sie können das, weil sie blitzschnell sehr viele Daten auswerten, viel mehr als Menschen es können. Trotzdem kann es sein, dass Computer zu Schlüssen kommen, die man nicht akzeptieren kann. Schlüsse, die gefährlich sind. Informatiker*innen wie Ulrike von Luxburg fragen sich deshalb auch, ob Computer immer gerecht sind.
Prof. Dr. Ilka Weikusat
Warum kann das Eis Geschichten erzählen?
Wenn es so etwas wie das Ende der Welt gibt, dann ist Ilka Weikusat schon mehrfach dort gewesen. Eigentlich hat die Erde wenn, dann zwei Enden, eins oben und eins unten: Oben ist die Arktis und unten die Antarktis. Fahrten ins ewige Eis, zum Süd- und zum Nordpol, sind für eine Wissenschaftlerin wie sie Dienstreisen: Ilka Weikusat ist Glaziologin, sie erforscht das Eis, das kilometerdick an den Polen lagert.

© Michael Kienzler
Eine Eisforscherin muss also auch Abenteurerin sein, sie geht auf echte Expeditionen in aufregende und noch immer fast unerforschte Gegenden der Welt, wo es bis zu minus 60 Grad kalt sein kann und man nicht mit einer Wollmütze, einem selbstgestrickten Schal und warmen Socken auskommt. Zwischendurch – und oft länger als ihr lieb ist – sitzt die Professorin aber auch am Schreibtisch, studiert Aufsätze, schreibt Gutachten oder Anträge. Ihr Büro ist in Bremerhaven, ganz im Norden Deutschlands. Sie lehrt aber auch in Tübingen, das ist ziemlich im Süden. Doch die Fahrten zwischen diesen beiden Städten sind nichts im Vergleich zu den großen Reisen, zu denen sie immer wieder aufbricht.
Wie kam Ilka Weikusat zur Glaziologie? Weil sie den Schnee und den Winter besonders mochte? Eigentlich mochte sie vor allem die Berge, Vulkane und die Natur. Ilka Weikusat wuchs an einem der östlichsten Zipfel Deutschlands auf, in Zittau in der Oberlausitz. In den Norden zog es sie erst später. „Meine Reiseleidenschaft war einer der Auslöser, warum ich zu dem Fach kam.“ Die Sehnsucht nach fernen Ländern war bei ihr schon in der Kindheit groß. In ihrer Heimat gab es ein Völkerkunde-Museum, in dem man aufregende Mitbringsel von fernen Reisen, sogar aus Grönland, sehen konnte. All diese Dinge wären für die kleine Besucherin immer in weiter Ferne geblieben, wenn es in Deutschland nicht einen politischen Umschwung gegeben hätte. 1989 fiel die Mauer, die Ost und West voneinander trennte, und diese Mauer hatte den DDR-Bürgern im Osten den Weg in westliche Länder versperrt. Ilka Weikusat war zwölf Jahre alt, als ihr plötzlich die Welt offenstand.
Nach dem Abitur war für sie klar, sie wollte Geologie studieren. In diesem Fach beschäftigt man sich mit Steinen und mit dem Aufbau und der Entstehung der Erde. Wer Steine untersucht, ist viel draußen, und sie wollte unbedingt viel draußen und in der Natur sein – egal, ob Berge, Wüste oder Eiswüste. „Dagegen sind große Städte für mich nur selten spannend. Ich mag Eismassen lieber als Menschenmassen. Allerdings mag ich auch Menschen, nur eben nicht in Massen.“
Aber was hat Eis, also gefrorenes Wasser, mit Steinen zu tun? Sehr viel, denn Eis ist auch ein Gestein. „Eis ist das häufigste Mineral an der Erdoberfläche. Das häufigste in der Erdkruste ist Quarz.“
In die Wissenschaft vom Eis ist Ilka Weikusat auch ein wenig hineingerutscht. Klar war aber, dass sie sich mit der Klimaerwärmung und ihren alarmierenden Folgen beschäftigen wollte. 2003 konnte sie dann zum ersten Mal an einem europäischen Forschungsprojekt in der Antarktis teilnehmen. Drei Monate lebte sie zusammen mit Wissenschaftlern aus verschiedenen Nationen und unterschiedlichen Fächern in einem kleinen Container und Zelt-Dorf im südlichsten Teil der Erde. Hotels oder Häuser gibt es dort keine. In der Arktis dagegen, am Eisschild in der Nähe des Nordpols, sind die Forschungsstationen in Flugreichweite zu grönländischen Siedlungen untergebracht.
Ilka Weikusat liebt das Leben in solcher Wildnis, und sie liebt den engen Austausch mit anderen Forscherinnen und Forschern. „Die Glaziologie ist ein sehr interdisziplinäres Fach. Da arbeiten außer Geologen, auch Physiker, Chemiker und Meteorologen, also Wetterkundler. Das kommt der Wissenschaft sehr zugute. Denn wenn alle in die gleiche Richtung oder im gleichen Schema denken, kommt man nicht weiter.“
Und was machen die Forscherinnen und Forscher im Eis? Sie bohren tief, kilometertief. Der Bohrkern, also die zutage geförderte Eissäule, wird in Stücke zerlegt, in Styroporkisten gepackt und im Labor in Deutschland oder in anderen Ländern untersucht. In Bremerhaven, wo ihr Institut für Polar- und Meeresforschung ist, nutzt die Forschung die großen Lagerhallen der Fischindustrie. Hier warten etwa 4000 exakt beschriftete Kisten mit Polareis darauf, analysiert zu werden.
Ilka Weikusat ist, wie man sich denken kann, nicht besonders kälteempfindlich. Aber nicht nur für ihre Polarexpeditionen braucht sie sehr warme Kleidung. Auch im Labor in Bremerhaven muss sie sich warm anziehen, viel wärmer als zu einem eisigen Winter-Spaziergang. „Die Temperatur im Labor liegt bei -20 Grad. Die Arbeit ist zwar anstrengend, aber einfach schön.“ Hier untersucht sie das Eis in seinem ursprünglichen, gefrorenen Zustand, andere Forscher untersuchen das geschmolzene Wasser. Und warum und was man daraus „lesen“ kann, das erfahrt ihr in ihrer Vorlesung.